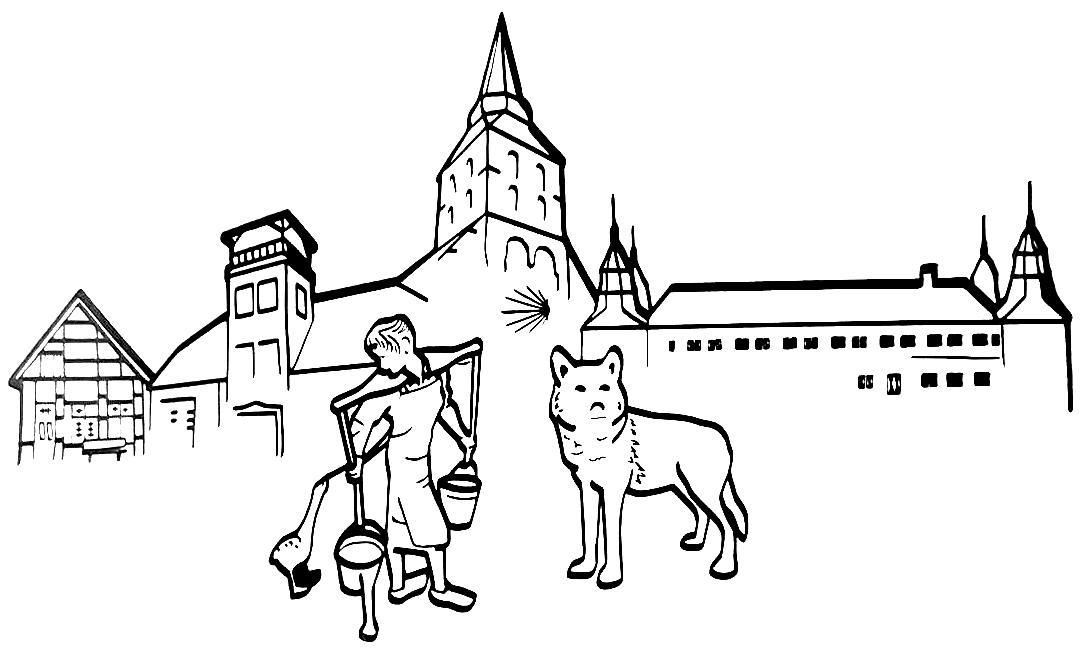Der Heimatverein engagiert sich für die heimische Natur. Weitere Aktivitäten siehe auch unten …

Behaartes Schaumkraut – scharf wie Kresse
Jeder hat es schon mal gesehen und sich vielleicht auch darüber geärgert – das Behaarte Schaumkraut (Cardamine hirsuta). Es taucht schon früh im Februar/März in den ansonsten noch eher kahlen Gartenbeeten auf und eh man sich versieht, hat es auch erste Samen gebildet. Bei dem Versuch, das Kraut dann noch zu jäten, werden diese rundherum über 1 m weit ins Beet geschleudert. Der Mechanismus funktioniert wie bei Springkraut – bei der geringsten Berührung der Samenschoten explodieren diese. Das Behaarte Schaumkraut wächst an offenen Standorten, wie auf Friedhöfen, an Weg- und Straßenrändern, auf Bürgersteigen in Pflasterritzen, auf Schotterflächen und Baustellen.
Cardamine hirsuta war vor 50 Jahren noch eine absolute Seltenheit. Die Art wurde wahrscheinlich über Baumschulen und Gärtnereien eingeschleppt und hat sich in den 1970er Jahren plötzlich massenhaft ausgebreitet. Inzwischen zählt es zu den häufigsten Garten-Wildkräutern. Es gehört zur Familie der Kreuzblütler und ist leicht an seinen zarten weißen Blüten zu erkennen. Anfangs bildet es eine bodennahe Blattrosette, aus der sich später bis zu 30 cm hohe Stängel mit gefiederten Blättern entwickeln. Es ist verwandt mit dem bekannteren zart lila Wiesenschaumkraut.
Das Behaarte Schaumkraut ist zwar ein lästiges Unkraut im Garten, das fast das ganze Jahr über große Mengen an Samen produziert und verschleudert, lässt sich aber durch Hacken und Jäten recht gut entfernen. Wer mag, kann dieses Unkraut auch zum Wildgemüse umfunktionieren. Die Blätter haben einen kresseähnlichen Geschmack und lassen sich im Salat verwenden. Am besten kommt es roh zur Geltung, aber es würzt auch Suppen, Soßen und Eierspeisen. Man gibt die Blätter aber erst zum Schluss an warme Speisen, denn zu viel Hitze lässt das feine Aroma verschwinden.
Die Blätter des Gartenschaumkrauts schmecken allerdings nur vor der Blüte und zu Blühbeginn. Wenn die Pflanze voll erblüht ist und schon Samenschoten angesetzt hat, dann verlieren die Blätter ihre angenehme Schärfe und werden immer bitterer und herber. Das „Schöne“ an dem „Unkraut“ ist, dass die Saison nicht gleich im Frühling vorbei ist, denn überall im Garten geht ganzjährig Samen auf und man findet somit immer wieder junge zarte Pflänzchen.

Schön auffällig – der Orangebecherling
Er ist grell wie eine Orange und erinnert an einen Becher. Der Pilz kann einen Durchmesser von 10 cm erreichen und wächst in der Regel gesellig direkt – d.h. ohne Stiel – aus der Erde. Dieser auffällige Pilz heißt Orangebecherling (Aleuria aurantia) und ist ein Schlauchpilz aus der Familie der Feuerkissenverwandten. Schlauchpilze sehen nicht schlauchförmig aus oder wachsen gar auf Schläuchen! Sie bilden viel mehr ihre Sporen in schlauchförmigen Zellen aus, die durch äußerliche Reize bei Sporenreife plötzlich explosionsartig ausgeschleudert werden. Dies ist bei Becherlingen zu beobachten, wenn z.B. durch Regentropfen Druck ausgeübt wird. Die Pilze „dampfen“ oder „rauchen“ dann plötzlich! Viele Hefe- und Schimmelpilze, aber auch begehrte Speisepilze wie Morcheln und Trüffeln gehören zu dieser Gruppe.
Der Orangebecherling setzt die Arbeit anderer Pilze bei der Verwertung von Holz fort. Er baut die noch im Holz vorhandenen Nährstoffe weiter ab, und macht sie wieder für das Pflanzenwachstum verfügbar. Er spielt also eine wichtige Rolle im Nahrungskreislauf des Waldes. Man findet ihn daher auf Rodungen, Brachen, Waldwegen, Lichtungen oder an Wegesrändern, insbesondere auf festem lehmigen Untergrund.
Hauptsaison hat der Orangebecherlingin der Regel von September bis zum ersten harten Frost. Bei einem besonders milden Start in den Winter sind aber auch noch Funde bis weit in den Dezember hinein möglich.
Ob der Orangebecherling giftig ist, da sind sich die Experten nicht einig. Vorsichtshalber sollte man die Finger davon lassen und sich einfach an dem Anblick erfreuen.

Giftiger Pilz in Kartoffelform
Er sieht aus wie eine Kartoffel. Ob er auch so schmeckt, sollte man besser nicht probieren. Denn der Kartoffelpilz, der jetzt überall im Wald aus dem Boden schießt, ist für uns Menschen ungenießbar. Er verursacht Verdauungsbeschwerden wie Erbrechen und Bauchschmerzen, akute Brechdurchfälle können ebenfalls auftreten. Zudem können Schweißausbrüche sowie niedriger Blutdruck mit Schwindel, Kollaps, möglicherweise bis zur Bewusstlosigkeit auftreten. Die Giftwirkung kann schon 30 bis 45 Minuten nach der Pilzmahlzeit auftreten. Auch Sehstörungen, Missempfindungen, Krämpfe und rauschartige Zustände sind nach dem Konsum von Kartoffelbovisten (Scleroderma)jedenfalls in einzelnen Fällen aufgetreten. Welche Giftstoffe den Pilz giftig machen, ist bisher nicht eindeutig geklärt.
Über die äußeren Merkmale ist der Kartoffelbovist mit essbaren Bovisten verwechselbar. Deshalb ist es wichtig, den Unterschied zu kennen. Alle Boviste, die innen völlig weiß sind, sind nicht giftig. Das Fleisch des Kartoffelbovistes ist in frühester Jugend metallisch gelblich, bald wird es völlig schwarz. Bei der Reife bricht die dicke Schale am Scheitel auf und gibt die nunmehr reife, schwarze, pulverige Sporenmasse frei. Der Geruch dieser Masse ist stechend leuchtgasartig. Wer weiß, wie Leuchtgas riecht, ist gewarnt.Der metallisch stechende Geruch lädt eigentlich nicht zum Essen ein. Dennoch wurde der Kartoffelbovist schon des Öfteren als Zugabe zu irgendwelchen Speisen serviert: Nämlich als billige Fälschung teurer Trüffel. Man verwendete das feingeschnittene schwarze, noch feste Fruchtkörperfleisch getrocknet als Trüffelersatz zum Würzen.
Aktivitäten
So haben die alten Apfelbäume im Waterforwinkel Plaketten bekommen, die über die verschiedenen Apfelsorten informieren.
Seit Jahren pflegt der Heimatverein unter der Regie von Mathias Struhkamp das Biotop „Othövers Bleiche“ an der Bernhardstraße. Es ist neben dem Haus Nr. 37 gelegen, wo alte Obstbäume und eine Wildblumenwiese das Auge des Besuchers erfreuen.
Großen Zuspruch erhalten von Gartenfachwirt Dieter Rogoll durchgeführten Kurse zum Schnitt von Obstbäumen (Foto).
Zu den Aufgaben des Heimatvereins gehört auch die Pflege der mittlerweile über 50 Bänke, die der Verein an Spazier-, Rad- und Wanderwegen aufgestellt hat.
Inzwischen sind die meisten Bänke mit Plaketten ausgestattet, auf denen die Notrufnummer 112 und eine Standortnummer eingearbeitet sind. Der genaue Standort ist bei der Leitstelle der Feuerwehr hinterlegt, die dann in einem Notfall dem Rettungswagen die genauen GPS-Daten übermittelt.

Franz Wemhoff (sitzend) und Gerd Gesenhoff haben die Notrufplatten angebracht.